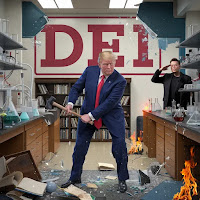Es lohnt sich, einen Blick auf die Aussagen zur Hochschul-/ Wissenschaftspolitik zu werfen. Vor allem im Abschnitt 2.4 Bildung, Forschung und Innovation finden sich ein wenig klar strukturierter Abschitt zur Wissenschaft. Da heißt es einleitend (S. 75):
WissenschaftsfreiheitWir erhalten Deutschland in Zeiten globaler Polarisierung als attraktives Zielland und sicheren Hafen der Wissenschaftsfreiheit für Forschende aus aller Welt. Mit einem „1.000 Köpfe-Programm“ werden wir internationale Talente gewinnen. Förderentscheidungen folgen wissenschaftsgeleiteten Kriterien. Wissenschaftlich relevante Datenbestände, deren Existenz bedroht sind, wollen wir weltweit sichern und zugänglich halten.
Der Passus liest sich als unmittelbare Reaktion auf die Wissenschaftsdestruktion durch POTUS Trump. Die Größen lesenswert, und wichtig sind die Überlegungen zur Datenrettung durch eine weltweite Sicherung. Das macht auch Deutschland für den Fall resilient, dass dereinst eine rechte Partei bei uns in die Regierung kommt… Wie realistisch es ist, mit der aktuellen Ausstattung deutscher Universitäten für US-Wissenschaftler attraktiv zu sein, das sei dahingestellt. Anstelle von "erhalten" wäre hier angesichts netto schrumpfender Hochschuletats besser die Rede von "wiederherstellen".
Resilienz des WissenschaftssystemsWir stärken die Forschungssicherheit, entwickeln gemeinsam mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen Leitlinien für den Umgang in sensiblen internationalen Kontexten und verbessern die Beratungsinfrastruktur. Wir bauen die Forschung zu Desinformationsakftvitäten aus und entwickeln ein Kompetenznetzwerk für unabhängige Chinawissenschaften.
Arbeits- und Studienbedingungen
Karrierewege in der Wissenschaft
Wir verbessern die Arbeitsbedingungen für Forschende, Lehrende und Studierende nachhaltig, machen Karrierewege verlässlicher und bilden dies in der Förderung des Bundes ab. Wir novellieren das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis Mitte 2026. Mindestvertragslaufzeiten vor und nach der Promotion werden wir einführen und Schutzklauseln auf Drittmittelbefristungen ausweiten. Mit einer Mittelbau-Strategie straffen wir die Projektförderung, sorgen grundsätzlich für längere Programmlaufzeiten, setzen Anreize für Departmentstrukturen und zur Entwicklung von Stellenprofilen. Wir bauen das Tenure-Track-Programm aus und verbessern die Rahmenbedingungen für mehr Dauerstellen. Wir wollen den Anteil von Frauen an wissenschaftlichen Führungspositionen weiter erhöhen – wir unterstützen das Kaskadenmodell und verstärken das Professorinnenprogramm.
Eine Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist dringend notwendig, wobei die Überlegungen der Ampelkoalition zu einer weiteren Verkürzung der Fristen eher kontraproduktiv waren, hätten die doch bereits die übliche Projektlaufzeiten von nur drei Jahren unterlaufen. Insofern ist es hier positiv zu vermerken, dass die Ideen statt weiterer Verkürzung der Befristung eher in Richtung längerer Mindestlaufzeiten der Verträge gehen. Beruhigend ist, dass dann auch für "längere Programmlaufzeiten" vorgesehen sind - wobei ich das möglicherweise misverstehe, wenn ich das als längere Projektlaufzeiten verstehe. Jedenfalls müssen Beschäftigungs- und Finanzierungsmöglichkeiten im Einklang stehen, da ansonsten Forschungsfreiheiten gar nichts bringen, denn Forschung wäre dann in der Praxis gar nicht mehr nicht umsetztbar. Prinzipiell spricht nichts gegen Karrierewege, die auf eine Abfolge von Projekten setzen, es dürfen diese nur nicht zu Prekariat und einziger Berufsoption werden. Mit den bisherigen Regelungen sind einige fähige Kolleg*innen nach einigen Jahren wertvoller Berufserfahrung einfach aus der Forschung in die Perspektivlosigkeit katapultiert worden. Das ist prekärer als alle prekären Situationen, die mit dem Gesetz verhindert werden sollen. Vielleicht wird das mal anders?
Wir gestalten die Regelungen zur Arbeitszeiterfassung an Hochschulen rechtssicher und praktikabel. Wir schaffen eine Regelung im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), die Arbeitsverhältnisse während eines Studiums vom Anschlussverbot ausnimmt.
Das klingt nach dem Gegenteil von Entbürokratisierung.
StudienfinanzierungWir wollen das BAföG in einer großen Novelle modernisieren. Die Wohnkostenpauschale erhöhen wir zum Wintersemester 2026/27 einmalig auf 440 Euro pro Monat und überprüfen diese regelmäßig. Die Freibeträge werden dynamisiert. Den Grundbedarf für Studierende passen wir in zwei Schritten (hälftig zum Wintersemester 2027/28 und 2028/29) dauerhaft an das Grundsicherungsniveau an. (...) Die Darlehensdeckelung bleibt unverändert. Den BAföG-Bezug wollen wir weiter vereinfachen, digitalisieren und beschleunigen. Die jährlichen Folgeanträge wollen wir vereinfachen, den Antrag für die Studienstarthilfe wollen wir in den BAföG-Antrag integrieren. Die Hinzuverdienstgrenze bleibt an die Minijobgrenze gekoppelt. Den Gesetzesvollzug für das Auslands-BAföG wollen wir beschleunigen und zentral im Bundesverwaltungsamt verankern. Beim KfW-Studienkredit als Ergänzung in besonderen Situationen setzen wir uns für faire Konditionen ein und stellen auch ein Produkt mit Zinsbindung zur Verfügung.
Begabtenförderung und StipendienWir stärken Begabtenförderwerke und die Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung und heben die Förderung deutlich an. Dabei sind bei allen Instrumenten die vollständige Digitalisierung und Vereinfachung des Antragsprozesses wichtig. Stipendien müssen in Art und Umfang ausgebaut und möglichst unbürokratisch vergeben werden.
Bemerkenswerterweise ist hier nicht von Chancengleichheit die Rede. Grundstzlich sind Verbesserungen hier dringend notwendig. Ob hier gute oder ausreichende Modelle dahinter stehen, kann ich nicht beurteilen.
Hochschulsanierung und -modernisierungWir legen eine Schnellbauinitiative von Bund und Ländern zur Modernisierung, energetischen Sanierung und digitalen Ertüchtigung von Hochschulen und Universitätskliniken, inklusive Mensen und Cafeterien als befristetes Investitionsprogramm auf.
Viele Unis leiden unter der zerbröselnden Betonarchitektur. Oft stehen aber auch einfach nicht ausreichende und brauchbare Lagerflächen zur Verfügung. Gut ist, dass hier auch Sozialflächen genannt werden. Neben großen Mensen und Cafeterien sind aber Sitzecken und Teeküchen, wie auch Gemeischaftsarbeitsräume ein wichtiges Element für den wissenschaftlichen Austausch und die Studienbedingungen der Studierenden.
Studium und LehreWir stärken Studium und Lehre systematisch und dynamisieren den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ auch über 2028 hinaus. Die Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ wird auf Basis der Evaluationsergebnisse weiterentwickelt.
Gut. Vor allem braucht es mehr Flexibilität in den Studiengängen - weniger Modularisierung, mehr individuelle Studienfreiheit bzw. Studienprofilierung. Hier muss Interdiszipinarität leichter werden.
Internationalisierung (S. 77)Wir werden die Mittel von Deutschem Akademischen Austauschdienst (DAAD), Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) sowie der Max Weber Stiftung ressortübergreifend kontinuierlich verstärken, damit sie ihre Programme wieder ausbauen können. Wir setzen uns für eine Fortsetzung von Erasmus+ ein, den Anteil beruflich Qualifizierter werden wir weiter steigern. Wir vereinfachen die Visa-Vergabe für Fachkräfte aus der Wissenschaft und Studierende.
Erasmus-Programme wären bürokratisch wieder einfacher zu gestalten.
früher gab es hier viele Möglichkeiten zwischen einzelnen Professuren
für studierende individuelle Studienprogramme zu gestalten, jetzt muss
es auf Ebene der Universitätsleitungen Vereinbarungen geben und
Studienleistungen in die heimischen Module passen. Das ist für kleine
Fächer und Universitäten zu aufwändig.
Forschungsförderung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (S. 76)Die DFG-Programmpauschalen werden wir für Neuanträge auf 30 Prozent anheben. Die Hälfte der Anhebung erbringt die DFG. Die andere Hälfte übernehmen Bund und Länder zu gleichen Teilen.
Das bedeutet unter dem Strich weniger geförderte Projekte. Oben ist von längeren Programmlaufzeiten die Rede. Unterm Strich bedeutet das sinkende Bewilligungsraten und mehr Arbeitszeiten für erfolglose Anträge für den Papierkorb.
Exzellenzstrategie (S. 77)Die Exzellenzstrategie werden wir in den Förderlinien Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten für eine mögliche Förderperiode ab 2030 grundlegend evaluieren.
Das sagt eigentlich gar nichts aus. Bislang hat dies zur Förderung weniger großer Universitäten zu Lasten der kleinen Universitäten geführt. Eine Fächervielfalt an einzelnen Universitäten steht dem Sterben kleiner Fächer in der Breite gegenüber.
Europäische und internationale Zusammenarbeit (S. 80)Wir setzen uns für ein eigenständiges, starkes EU-Forschungsrahmenprogramm und einen weiterhin unabhängigen European Research Council (ERC) ein. Wir unterstützen nicht erfolgreiche Projekte bei Wiedereinreichung eines vom ERC als exzellent bewerteten Antrags. Wir wollen das Weimarer Dreieck um eine Wissenschaftsplatform erweitern und die Wissenschaftsbeziehungen in der EU, insbesondere mit Mittel- und Osteuropa, ausbauen. Etablierte Instrumente wie die Wissenschaftskonferenz „Building Bridges for the Next Generation“ unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, stärken wir.
StrukturreformenWir hebeln Forschungsmittel mit Dritten. Wir bündeln Forschungsförderung des Bundes. Die Ressortforschung ist davon ausgenommen. Wir bauen Bürokratie zurück und denken Prozesse von Grund auf neu. Wir unterstützen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) dabei, sich komplementärer und effizienter aufzustellen. Forschung muss in der gesamten Bandbreite, von Grundlagen bis Anwendung, gedacht werden. Durch Hub-Strukturen wollen wir Innovationsräume schaffen. Diese sollen Forschungsinfrastrukturen und Forschungsaktivitäten standort- und akteursübergreifend zu Ökosystemen vernetzen.
Bündeln von Forschungsförderung klingt sehr nach einem Euphemismus für das Kürzen von Forschungsförderung.
Unter dem Begriff Bildung, Forschung und Innovation (S. 71) heißt es allerdings:
Bildung, Forschung und Innovation sind der Schlüssel für die Zukunft unseres Landes. Wir sind stolz auf die herausragenden Leistungen, die die Wissenschaft in den Neuen Bundesländern, durch unsere gemeinsamen Investitonen erbringt. Wir wollen Deutschland fit machen und Bildung, Forschung und Innovation einen größeren Stellenwert in unserem Land geben. Dazu werden wir massiv investieren.
Im Jahr 2023
betrug der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nach vorläufigen Angaben rund 3,11 Prozent (ca. 129 Milliarden €). Der Koalitionsvertrag sieht eine Steigerung bis 2030 auf jährlich mindestens 3,5 Prozent des BIP vor:
Verlässlichkeit und Planbarkeit der ForschungsförderungWirtschaft und Staat sollen bis 2030 jährlich mindestens 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufwenden. Wir werden bis 2028 die Weichen für eine dynamisierte Fortschreibung des PFI stellen. Damit schaffen wir Planungssicherheit für die Leibnitz-Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschatt und die Deutsche Forschungsgemeinschatt (DFG). Bei der steuerlichen Forschungszulage heben wir den Fördersatz und die Bemessungsgrundlage deutlich an und vereinfachen das Verfahren. Großen Forschungsmaßnahmen des Strukturwandels eröffnen wir ab 2029 die bewährten Rahmenbedingungen der Regelfinanzierung der Forschungsförderung.
Ein Element dieser nicht näher präzisierten Investitionen scheint der DigitalPakt 2.0 (S. 72).
Mit dem neuen DigitalPakt bauen wir die digitale Infrastruktur und verlässliche Administration aus. Wir bringen anwendungsorientierte Lehrkräftebildung, digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung, selbst-adaptive, KI-gestützte Lernsysteme sowie digitalgestützte Vertretungskonzepte voran.
Investitionen in die Forschungsinfrastruktur (S. 80)Deutschland soll die erforderlichen Investitionen der FIS-Roadmap tätigen und sich damit in der EU erfolgreich einbringen. Wir entwickeln die FIS-Roadmap kontinuierlich weiter. Wir werden die Aktivitäten für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) verstetigen. Wir beteiligen uns am Wettbewerb um einen Gravitationswellendetektor. Wir setzen mit einer Bund-Länder-Initiative im Forschungsbau Impulse, unter Einschluss strukturschwacher Regionen. Wir stärken das Forschungsbauprogramm nach Art. 91b Grundgesetz und bilden darin Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit ab.
Insgesamt liegt ein Schwerpunkt der Förderung in einigen Themen der Digitalisierung und Schlüsseltechnologien:.
Forschungs- und Innovationsförderung (S. 77ff.)Wir starten eine Hightech Agenda für Deutschland unter Einbindung der Länder. Wir wollen dazu in definierten Missionen technologieoffene Innovationsökosysteme und Forschungsfelder organisieren und fördern mit klaren Zielen und Meilensteinen und unter Einbeziehung von universitären und außeruniversitären Akteuren, Industrie und Start-ups. Neben Förderprogrammen wird der Staat auch als Ankerkunde tätig. Wir priorisieren für die Hightech Agenda in einem ersten Schritt die Forschungs- und Innovationsförderung des Bundes auf folgende Schlüsseltechnologien:
- Künstliche Intelligenz: Wir starten eine KI-Offensive mit einem 100.000-GPU-Programm (AIGigafactory). Wir stellen eine exzellente Infrastruktur bereit, die Forschung und Hochschulen durch den Auf- und Ausbau von Hoch- und Höchstleistungsrechenzentren den Zugang zu entsprechenden Rechnerinfrastrukturen ermöglicht. Wir wollen im Verbund KI-Spitzenzentren errichten.
- Quantentechnologien: Wir bauen das nationale Quantenökosystem aus. Leistungsfähige Quantensysteme machen wir in der Fläche verfügbar und sorgen für die beschleunigte Entwicklung von mindestens zwei Quantenhöchstleistungsrechnern im Wettbewerb.
- Mikroelektronik: Wir stärken den Mikroelektronikstandort Deutschland und denken dabei Forschung, Fachkräfte und Fertigung zusammen – wir bauen ein Kompetenzzentrum für Chipdesign auf.
- Biotechnologie: Wir fördern die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Therapien durch die lebenswissenschaftliche, molekularbiologische und pharmazeutische Forschung sowie die Agrar-/Ernährungswissenschaften und Biodiversitätsforschung. Wir schaffen eine Nationale Biobank als Grundlage für Präventions-, Präzisions- und personalisierte Medizin.
- Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung: Wir bringen neuartige Klimatechnologien voran. Wir bauen die Forschung im Bereich Photovoltaik, Windenergie, Geothermie, Wasserstoff sowie Speichertechnologien wie zum Beispiel Batterien aus. Wir wollen die Fusionsforschung stärker fördern. Unser Ziel ist: Der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen.
Strategische Forschungsfelder
- Klimaneutrale Mobilität: Wir intensivieren unsere Forschungsaktivitäten für die Dekarbonisierung der bodengebundenen Mobilität sowie der Schiff- und Luftfahrt. Der verlässliche Auf- und Ausbau der Batterieforschung über die Kompetenzcluster spielt ebenso wie die vernetzte Mobilität eine zentrale Rolle.
- Gesundheitsforschung: Wir stärken die Gesundheitsforschung auch mit Fokus auf personalisierte Medizin. Den strategischen Ansatz bei der Gen- und Zelltherapie führen wir fort. Wir unterstützen die Bemühungen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) zur Gründung von Außenstellen, um so den Zugang zu Innovationen und Forschung flächendeckend zu verbessern. Wir bauen im Bereich der onkologischen Forschung und klinischen Versorgung relevante Netzwerke aus (DKTK, NCT). Wir fördern Forschung zu Frauengesundheit und positnfektiösen Erkrankungen (Long COVID, ME/CFS und PostVac).
- Meeres-, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung: Wir erneuern die deutsche Forschungsflotte und verstetigen die Deutsche Allianz Meeresforschung. Wir stärken die Forschung zu Klimawandel, Klimafolgen und Klimaanpassung sowie zu klimarelevanten Ökosystemen wie Wäldern, Küsten, Mooren, Hochgebirgen und zur Kreislaufwirtschaft.
- Geistes- und Sozialwissenschaften: Wir stärken die Förderung von Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, vor allem die Erinnerungskultur, politische Bildung und Demokratieforschung sowie die Sozialpolitikforschung. Wir entwickeln ein Kompetenznetzwerk für jüdische Gegenwartsforschung und stärken die Antisemitismusforschung.
- Sicherheits- und Verteidigungsforschung sowie Dual-Use: Wir bauen die Friedens- und Konfliktforschung sowie Regionalforschung (zum Beispiel zu Osteuropa, China, USA) aus und schaffen eine Förderkulisse für Sicherheits- und Verteidigungsforschung einschließlich Cybersicherheit und sicherer Infrastrukturen, um Kooperation von Hochschulen und außeruniversitärer Forschung mit Bundeswehr und Unternehmen gezielter zu ermöglichen.
- Luft- und Raumfahrt: Wir starten eine Offensive für Luft- und Raumfahrt und bringen Spitzenforschung und Kommerzialisierung erfolgreich zusammen. Wir errichten eine Nationale Hyperloop Referenzstrecke.
Wider Erwarten werden die Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften hier explizit als strategisches Forschungsfeld genannt. Prinzipiell sieht es hier auch so aus, als hätte jemand erkannt, dass eine kulturelle und historische Bildung wichtig ist, um eine Gesellschaft gegenüber populistischer (und nationalistischer) Geschichtsdeutung resilient zu machen und Demokratie und ein soziales Zusammenleben zu stärken. (Vorausgesetzt, man hat richtige und nicht rechte Geschichtslehrer.)
Transfer
Wir schaffen eine Dachmarke „Initiative Forschung & Anwendung“ mit drei Säulen: (1) Die Programme ZIM, IGF und INNO-KOM, (2) „Transferbooster“ mit den Transfer-Programmen des BMBF inklusive DATI Pilot unter Konsortialführerschaft der HAW, (3) „Deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft“ (DAFG) mit den Programmen „Forschen an HAW“ und „FH Personal“. Die DAFG soll perspektivisch in den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) aufgenommen werden. Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) müssen angemessen am Förderaufkommen der DFG beteiligt werden. Wir bauen die Förderprogramme WIR, RUBIN und T!Raum aus. Wir fördern soziale Innovationen und nutzen dafür Gelder aus nachrichtenlosen Konten in einem revolvierenden Fonds.
Transfer aus den Wissenschaften ist sicher wichtig, bedenklich ist aber, dass dies auch noch unter dem Förderaufkommen der DFG geschehen soll.
Open Access/ Open Data
Wir sorgen für unsere digitale SouveränitätWir definieren Ebenen übergreifend offene Schnittstellen, offene Standards und treiben Open Source mit den privaten und öffentlichen Akteuren im europäischen Ökosystem gezielt voran, unter anderem mit dem Zentrum Digitale Souveränität (ZenDiS), der Sovereign Tech Agency, der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Dafür richten wir unser IT-Budget strategisch aus und definieren ambitionierte Ziele für Open Source. Wir verankern ein Datendoppelerhebungsverbot (Once-Only) und beseitigen Digitalisierungshemmnisse.
Anderswo (S. 69) ist von dem Grundsatz „public money, public data“ und einem Rechtsanspruch auf Open Data bei staatlichen Einrichtungen die Rede.
Innovationsfreiheitsgesetz (S. 79)(...) Wir erleichtern die Datennutzung (BDSG) und werden ein Forschungsdatengesetz noch dieses Jahr vorlegen. Wir legen eine nationale IP-Strategie (geistiges Eigentum) vor. Wir ermöglichen Ausgründungen in 24 Stunden und führen dazu an Hochschulen und Forschungseinrichtungen verbindlich standardisierte Ausgründungsverträge ein, die insbesondere Nutzungsrechte von geistigem Eigentum gegen einen marktüblichen Anteil ermöglichen. Wir wollen Gemeinnützigkeitsschranken entlang aller Transferpfade reduzieren. Wir stellen sicher, dass die Agentur SPRIND weiterhin wissensgetriebene Sprunginnovationen fördert. Das Besserstellungsverbot für gemeinnützige Forschungseinrichtungen flexibilisieren wir und novellieren dazu das Wissenschaftsfreiheitsgesetz.
Bemerkenswerterweise erhält die Wissenschaftskommunikation einen eigenen Abschnitt:
Wissenschatsskommunikation und -verbreitung (S. 75f.)
Wissenschaftskommunikation muss fester Bestandteil von Wissenschaft und Forschungsförderung sein. Wir setzen im Rahmen des PFI und im Akademienprogramm hier ein Ziel. Wir gründen eine unabhängige Stiftung für Wissenschaftsskommunikation und -journalismus. Zur wissenschaftsbasierten Faktenvermittlung sind Forschungsmuseen wichtig.
Entbürokratisierung
Innovationsfreiheitsgesetz (S. 79)Wir geben der Forschung mehr Freiheit und entfesseln sie von kleinteiliger Förderbürokratie. Wir schaffen Bereichsausnahmen für Forschung unter anderem im Umsatzsteuergesetz und identifizieren weitere Bereiche etwa im Vergaberecht. Wir werden Antragslogiken, Nachweiserfordernisse und Regularien entschlacken und Entscheidungen beschleunigen. Hierzu gehören zum Beispiel eine flexiblere Bewirtschaftung von Projektmitteln und Verschlankung der Steuerungssystematik der Projektträger. Wir regulieren die Fusionskraftwerke außerhalb des Atomrechts. Wir führen eine zeitgemäße Regelung von Zell- und Gentherapien in der Forschung ein. Wir schaffen ein eigenständiges Gesetz für wissenschaftliche Tierversuche. ...
Höchst notwendig und dringend ersehnt! Hoffentlich gilt das nicht nur für die Atomforschung.
Es gibt noch viele weitere Punkte, an denen das nötig wäre. Vorsorglich sollte betont werden, dass Digitalisierung nicht automatisch eine Entbürokratisierung bedeutet. Vielleicht bedeutet sie weniger Papier, aber nicht unbedingt weniger Zeitaufwand.
Kulturelles Erbe
Im Vergleich zum Vertrag der gescheiterten Ampelkoalition (Archaeologik 25.11.2021) scheint das eher viel Text zur Wissenschaft. Allerdings ist vom kulturellen Erbe nur in Bezug auf die Heimatvertriebenen die Rede (S. 121).
Kulturelles Erbe der HeimatvertriebenenZur Förderung des kulturellen Erbes der Heimatvertriebenen werden wir die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen auf eine verlässliche finanzielle Basis stellen und die Bundesförderung nach §96 Bundesvertriebenengesetz zukunftsfest gestalten.
Interne Links
Beobachtungen zu Koalitionsverträgen auf Archaeologik:- Mehr Fortschritt wagen.? Archaeologik 25.11.2021
- Die Archäologie der neuen Bundesregierung. Archaeologik (27.12.2013)
aus den Ländern
- Show statt Substanz? Die Denkmalpflege im grün-schwarzen Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg. Archaeologik (9.5.2021)
- Denkmalpflege in den neuen Landesregierungen NRW und S-H. Archaeologik (19.6.2017)
- Bekenntnis zu Veranlasserprinzip und Schatzregal: Koalitionsvertrag NRW. Archaeologik (12.6.2012)
- Schleswig-Holstein: Koalitionsvertrag sieht Novellierung des Denkmalschutzgesetzes vor. Archaeologik (10.6.2012)
- (Bau)Denkmalpflege im rot-grünen Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz. Archaeologik (7.5.2012)
- Erneuern und Bewahren! Aspekte der Denkmalpflege im Grün-Roten Koalitionsvertrag BaWü. Archaeologik (30.4.2011)
Link
- Der Koalitionsvertrag 2021 als pdf auf den Seiten der SPD - https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
- Der Koalitionsvertrag 2025 als pdf auf den Seiten der SPD - https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag_2025.pdf
.jpeg)